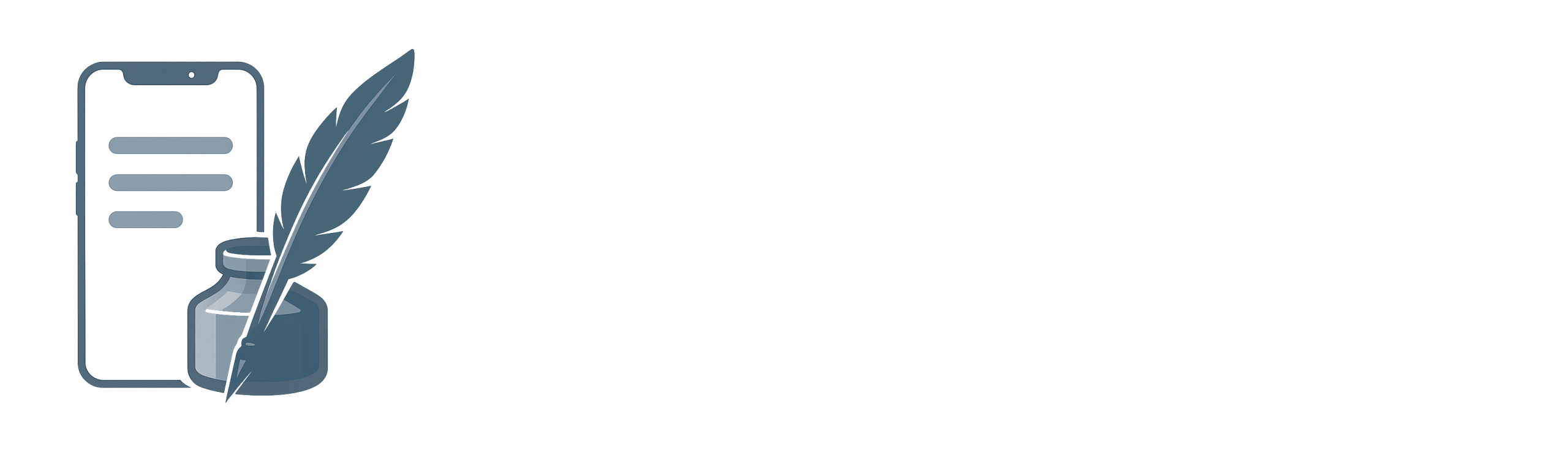Im Stück spielen Schauspieler Schauspieler, die Schauspieler spielen. Foto: Elke Hussel
Sardinen, Slapstick, Szenenapplaus
Manchmal ist Theater wie ein Fußballspiel: voller Laufwege, riskanter Dribblings, genialer Vorlagen – und mitunter auch voller Eigentore. Michael Frayns Farce „Der nackte Wahnsinn“ ist in dieser Hinsicht die Königsklasse. Wer sie spielt, betritt kein gemütliches Kleinfeld, sondern läuft in einer vollbesetzten Arena auf, in der jede Bewegung sitzt, jede Flanke ankommen muss und das Publikum mit der Leidenschaft einer Fankurve reagiert.
Erster Akt im voll besetzten Freiberger Theater: Ein grüner hoffnungsvoller Vorhang, quasi Fußballrasen in der Vertikalen, öffnete das Spielfeld der Komödie. Die Generalprobe des Boulevardstücks „Nackte Tatsachen“ wirkte wie ein Aufwärmtraining: Der Ball wird verstolpert, Textpässe kommen zu spät, der Regisseur fuchtelt am Spielfeldrand wie ein Trainer, der seine Spieler nicht erreicht. Die Mannschaft besteht aus zwei Paaren, aus einem Handwerker, einem Einbrecher, einer nicht mehr ganz frischen Haushälterin, einem Regisseur und seiner Assistentin und Tellern voller Sardinen. Die kleinen Fische sind dabei mehr als ein Requisit, sie verkörpern das Spielprinzip. Sardinen tauchen auf und verschwinden, sind Accessoire und Stolperfalle. Sie sind Massenware, austauschbar. Der Running-Sardinen-Gag funktioniert durch permanente Wiederholung. Die Mannschaft ist eigentlich zu groß für das kleine Spielfeld, wie Sprotten in der Dose drängen sich die Akteure durch Türen und Konflikte. Während Eifersucht, Affären und Chaos toben, dreht sich doch alles um die lächerlichste Kleinigkeit: Sardinen. Wie ein abgefälschter Ball entscheidet gerade das Nebensächliche im Spiel.
Der erste Akt zieht sein Vergnügen aus bekanntem Komödienhandwerk. Sprachwitz, Missverständnis, Paradoxon, klemmende Türen, Sardinen, die an der exakt falschen Stelle liegen. Ganz nebenbei wird das Publikum mit Texten und Bühnenwegen vertraut gemacht. Und aus diesem Wissen speisen sich die Pointen des zweiten und dritten Aktes. Noch scheint das Chaos irgendwie beherrschbar. Die Zuschauer schmunzeln und spüren: Die Mannschaft hat Potenzial, sie muss nur ihren Rhythmus finden.
Dann folgt der zweite Akt – das Spiel kippt in eine völlig andere Dimension. Wir wechseln die Perspektive, stehen nun quasi selbst in der Kabine und sehen das, was auf dem Rasen verborgen bleibt: das Gewusel, die Fouls abseits des Balles. Auf der Bühne bedeutet das: Stummfilmhaftes Spiel und große Gesten, während vorne das Boulevardstück weiterläuft. Hier agierte das Ensemble mit Tempo und Körpereinsatz. Und es wird klar, weshalb der Originaltitel „Noises off“ (Geräusche hinter der Bühne) heißt.
Das Publikum jubelte, doch bisweilen verlor sich die Mannschaft im gegnerischen Strafraum in Übersteiger und Kabinettstückchen. Ein gezielter Steilpass mit tragischer Note hätte den Figuren mehr Substanz verliehen. Denn wie im Fußball gilt auch auf der Bühne: Erst der Fehlpass, dieser kleine Hauch Tragik, gibt der Komödie ihre eigentliche Würze.
Im dritten Akt schließlich zerbricht die Ordnung endgültig. Hier geraten die Spieler ins offene Chaos: Doppelpässe misslingen, der Torwart läuft nach vorn, der Ball prallt an die Latte. Auf der Bühne bedeutet das: Türen schlagen ins Leere, Requisiten verschwinden, Dialoge brechen mitten im Satz ab. Und doch entsteht gerade daraus der größte Jubel. Es ist das anarchische Finale, das Stadion bebt, weil jede Panne, jedes Eigentor, jeder Zufall zum Höhepunkt wird.
Das Faszinierende: Dieses Chaos ist in Wahrheit minutiös einstudiert. Keine Pointe, kein Zusammenprall, kein Sturz ist Zufall. Es ist Taktiktraining auf höchstem Niveau. Das Ensemble spielte wie eine Mannschaft, die nicht nur das System des Trainers verinnerlicht hat, sondern auch die Laufwege der Kollegen kennt. Man spürte, dass jeder weiß: Wo stehe ich, wenn die Pointe von links kommt? Wer deckt ab, wenn jemand stolpert? Wer fängt die Flanke ab, wenn der Sardinenteller in die falsche Richtung segelt?
Schauspielleiter Stephan Bestier nannte die Aufführung dieses Stücks Teamsport. Und ja, die körperliche Leistung verdient höchsten Respekt. Zwei Stunden lang rennen, stürzen, Treppen erklimmen, wieder herunterfallen – das ist ein Fitnessprogramm, das so mancher Bundesligist anerkennend quittieren würde.
Und doch blieb der Eindruck von Leichtigkeit, als wäre es ein lockerer Sommerkick im Park. Am Ende brandete Applaus auf wie nach einem entscheidenden Siegtreffer in der Nachspielzeit. Das Publikum jubelte, lachte, pfiff anerkennend, klatschte stehend. Man verließ den Saal wie Fans nach einem gewonnenen Pokalfinale: erschöpft vom eigenen Lachen, voll Respekt für die Spieler auf dem Feld, und mit dem sicheren Gefühl, dabei gewesen zu sein bei einem der ganz großen Matches.
„Der nackte Wahnsinn“ zeigte sich hier als das, was es ist: ein Champions-League-Spiel des Theaters, Hochleistungssport in Kostüm und Maske. Ein Stück, das beweist: Theater ist der schönste Mannschaftssport der Welt.

Erleichterung beim Schlussapplaus, Foto: Elke Hussel