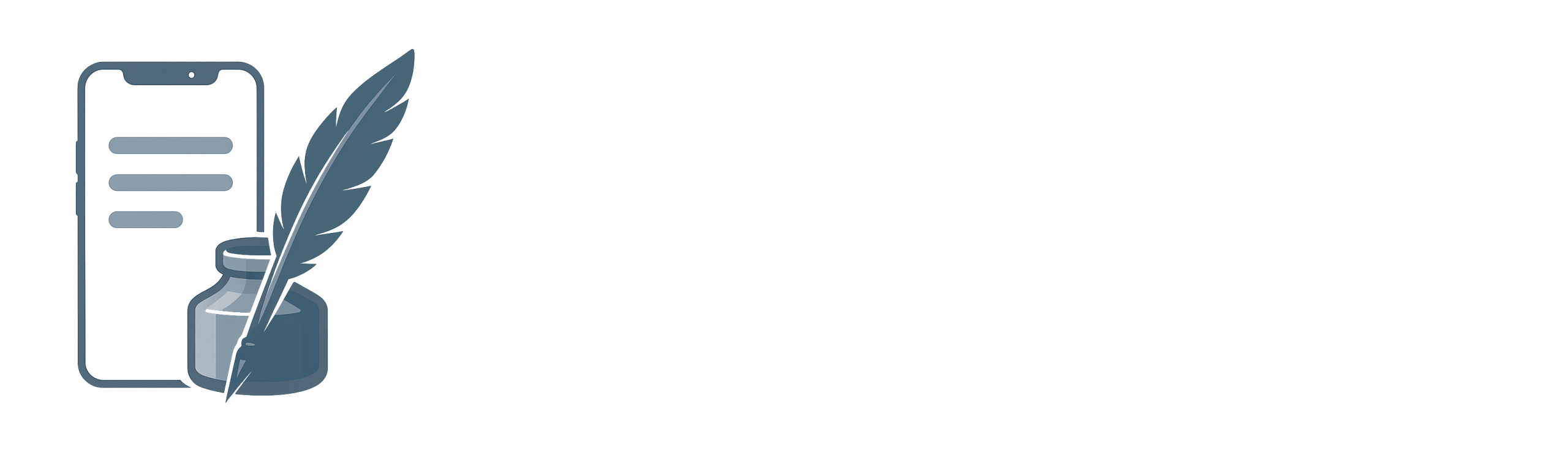Am Ende eines grandiosen Abends. Foto: Elke Hussel
Verführung und verblüffende Bildkraft
Der Kit-Kat-Klub ist ein gefährlicher Ort. Wer dort tanzt, entkommt der Geschichte nicht – nur dem Augenblick. Die Freiberger Inszenierung von John Kanders Musical „Cabaret“ zeigt eindrücklich, wie nah Vergnügen und Verhängnis beieinanderliegen können. Und sie tut es mit einer klaren Handschrift: rau und reduziert.
Schon das Bühnenbild von Johannes Pölzgutter, der auch die Regie verantwortet, setzt den Ton: Kein flirrendes Varieté der Goldenen Zwanziger, sondern eine Art-Deco-Tapete an der Rückwand und viel Holz. In der Mitte der Bühne eine kreisrunde Öffnung – wie ein Kameraauge, das alles sieht und dokumentiert. Diese Öffnung ist mehr als ein Effekt: Sie wird zum multifunktionalen Extraraum, mal Zugabteil, mal Pension, mal Obsthandlung. Ein Bühnenkonzept, das die Trennung zwischen Realität und Inszenierung auflöst. Trotz des reduzierten Bühnenbildes schwelgt die Inszenierung im Detail. Das Publikum schwankt zwischen Ergriffenheit und Freude, wenn Susanne Engelhardt eine Ananas auf ein rotes Samtkissen bettet. Im Scheinwerferlicht wird die Frucht zur Ikone des Alltagsabsurden und spiegelt doch die Sehnsucht nach Exotik. Das Kameraauge projiziert den Schnitt durch eine sich drehende Ananas, das ist gleichermaßen witzig, erhebend und irgendwie transzendent.
Musikalisch und darstellerisch trägt den Abend einer, der nicht nur moderiert, sondern seziert: Alexander Donesch als Conférencier. Er ist der Ankermann des Abends. Wo andere verführerisch blinzeln, blickt er direkt ins Publikum. Donesch gestaltet seine Figur mit elektrisierender Präzision – charmant, diabolisch, gnadenlos präsent. Seine Gesten schneiden, seine Stimme zieht Linien durch die Szene. Der Mann ist eine Erscheinung. Er führt und verführt den Kit-Kat-Club, die Figuren auf der Bühne und das Theaterpublikum. Er ist die Freiberger Liza Minnelli – ikonisch, ironisch, distanziert, handwerklich brillant.
Anna Burger als Sally Bowles geht einen völlig anderen Weg. Blond, weiß gekleidet, fast ätherisch, verweigert sie jede Nähe zur berühmten Liza-Minelli im schwarzen Frack. Sie versucht, die Figur aus dem Schatten des Mythos zu lösen – das ist mutig. Ihre Sally ist weniger Glanz, mehr Bruch. Gesanglich sicher, darstellerisch überzeugend, bleibt sie im Unentschlossenen. Sally liebt die Bühne, weil es das ist, was sie kennt.
Yannik Gräf als amerikanischer Schriftsteller Cliff Bradshaw überzeugt mit ehrlichem Spiel. Er gibt dem moralisch Suchenden einen glaubwürdigen Ton, ohne Pathos, aber auch ohne Überraschung. Seine Rolle inmitten der Doppelbödigkeit ist ja höchst undankbar. Denn die Geschichte wird aus der moralischen Position der Sieger erzählt, zu denen er im Nachhinein gehört. Er ist auch der einzige, der die Szenerie verlässt und verlassen kann. Das Zusammenspiel mit Burger funktioniert solide, das Publikum ahnt mehr, als es fühlt.
Ganz anders die Nebenfiguren: Susanne Engelhardt als Fräulein Schneider und Andreas Kuznik als Herr Schultz bringen Wärme, Witz und Menschlichkeit in die reale Welt. Ihr Duett ist der leise Gegenentwurf zum grellen Showlicht – man glaubt diesen beiden jede Falte, jede Hoffnung, jede Resignation. Ihre Szenen sind die menschliche Erdung des Abends.
Musikalisch betont das Orchester unter Bennet Eicke-Klava weniger Swing, mehr die Struktur. Die Arrangements klingen herb, rhythmisch kantig, als wollten sie jede Versuchung brechen. Ab und zu quäkt die (Klezmer-) Klarinette heraus, wie eine Figur, die sich verlaufen hat.
Die Freiberger Produktion hat Kraft. Sie ist durchdacht, klug gebaut, visuell markant. Doch sie verharrt in der Ästhetik. Der Kopf applaudiert, das Herz zögert. Zwischen formaler Brillanz und innerer Erschütterung klafft ein winziger Spalt.
„Cabaret“ ist mehr als ein Musical – es ist ein Kulturkommentar. Die Vorlage geht auf Isherwoods „Berlin Stories“ zurück, ein literarisches Zeugnis aus der untergehenden Weimarer Republik. Das Musical selbst entstand 1966 am Broadway, mit Texten von Fred Ebb und dem Buch von Joe Masteroff. Es war seinerzeit revolutionär: kein Märchen, keine heile Welt, sondern eine Mischung aus Entertainment und politischer Warnung.
Die berühmte Filmversion von Bob Fosse (1972) veränderte die Wahrnehmung des Stücks radikal. Mit Liza Minnelli als Sally Bowles und Joel Grey als Conférencier wurde aus der sozialkritischen Revue ein düsteres Psychogramm einer Gesellschaft im Taumel. Der Film gewann acht Oscars – und schrieb die Ästhetik des modernen Musikfilms neu: keine bunten Ensembles mehr, sondern gebrochene Individuen.
Diese Tradition greift die Freiberger Inszenierung auf – bewusst jenseits aller Goldstaubromantik.